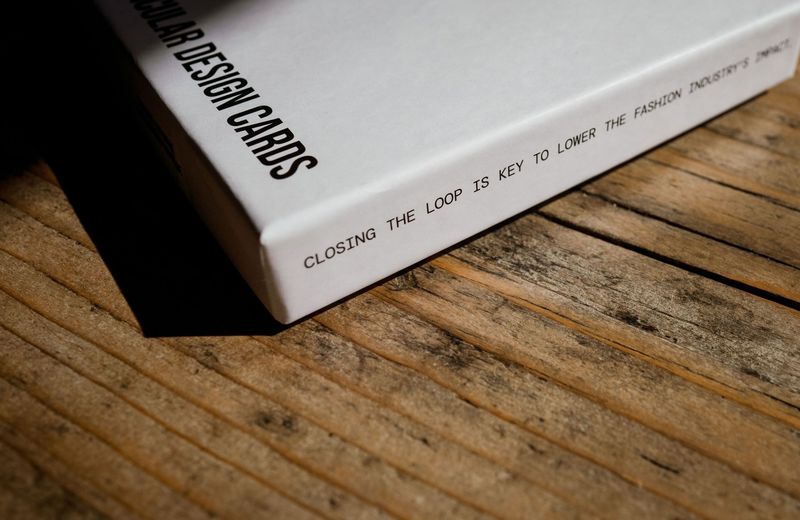Mode, Design, Theorie
Interview mit Barbara Schmelzer-Ziringer über ihre Publikation, die im Böhlau Verlag, Wien/UTB erschienen ist.
In Deiner neuen Publikation Mode Design Theorie betrachtest Du scharfsinnig aktuelle Diskurse über Mode. Dabei handelst Du viele wichtige Themen ab, die heute diskutiert werden. Für welche Zielgruppe hast Du das Buch geschrieben?
Schön zusammengefasst, außer, dass mein Buch sich von anderen zahlreichen Publikationen zu „Mode“ insofern unterscheidet, als dass es nicht vordergründig um Mode, sondern um Modedesign, geht. Die Publikation ist tatsächlich für alle gedacht, die sich für Modedesign interessieren. Damit möchte ich letztendlich eine Lücke schließen und versuchen zu beantworten, wo das Design innerhalb der Modetheorie situiert ist, denn Menschen machen eigentlich „die Mode“, wobei sie oft als autonome soziale Kraft beschrieben wird.
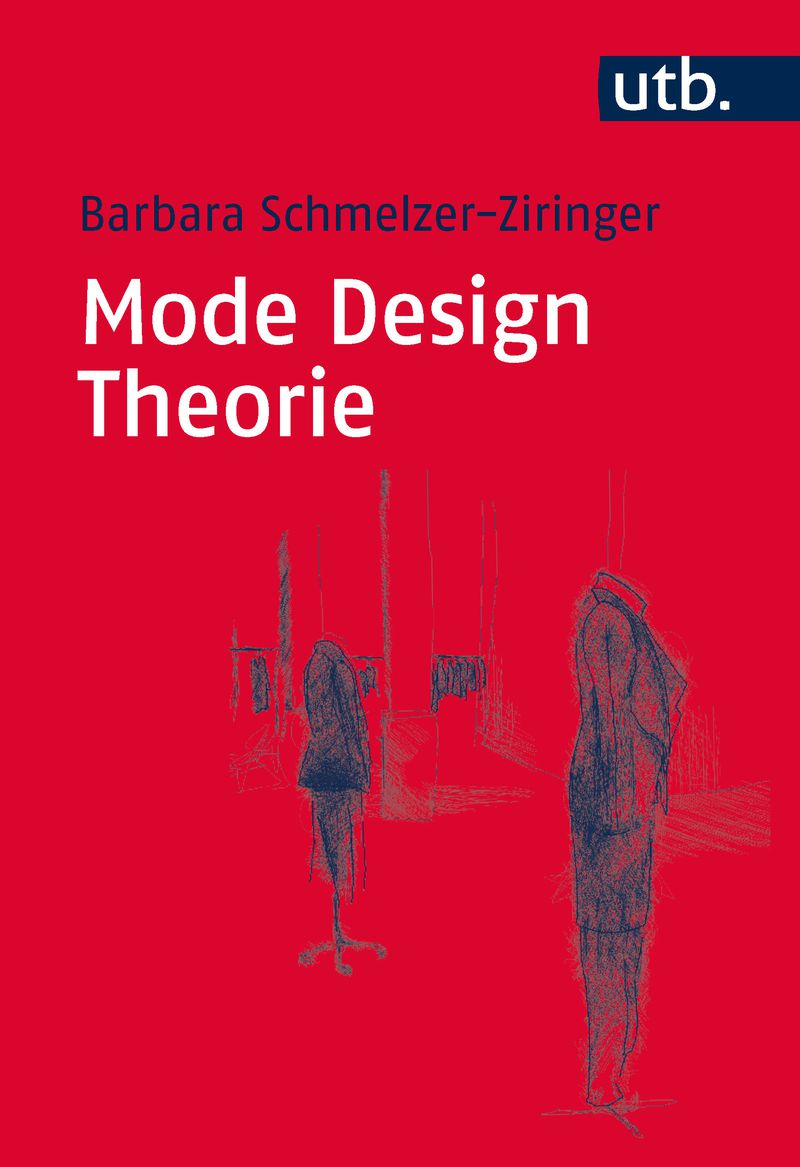

Das Buch basiert auf Erfahrungen, die Du als Praktikerin im Modedesignbereich gemacht hast. Welche Erfahrungen waren dabei vor allem entscheidend?
Als ich in den 1990er-Jahren mit meiner Ausbildung zur Modedesignerin angefangen hatte, habe ich festgestellt, dass diese im Allgemeinen sehr frauenmodelastig war. Die Ausbildungssituation war damals so, dass man in den Modelehrgängen hauptsächlich „Damenmode“ gelernt hat. Herrenschneiderei war dagegen vornehmlich ein Lehrlingsberuf. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich auch Unisex-Modelle gemacht – also Bekleidung die letztendlich je nach Größe und Gradierung für Männer und Frauen geeignet ist. Zu dieser Zeit habe ich im Atelier von Edwina Hörl in Wien gearbeitet. Ich hatte aber im Bereich der Männermode keine Erfahrung. Ich wusste nicht, wie Herrenschnitte funktionieren müssen oder wie eine Herrenkollektion konzipiert wird. Das habe ich erst später bei Stephan Schneider in Antwerpen gesehen. Letztendlich interessierte ich mich aber durch diese Situation immer mehr für die unbalancierten Geschlechterverhältnisse im Bereich der Mode. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte, die ich in dem Buch erörtere.
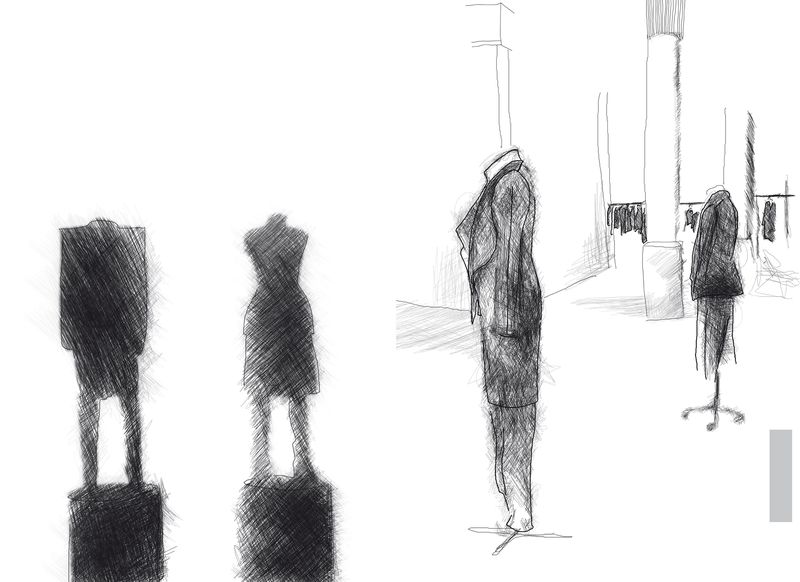
Du hast dann Gender Studies am Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Welche wichtigen Impulse hast Du dort in Bezug auf das Thema bekommen?
Der Punkt ist der, dass es extrem viele Impulse waren, weil das Studium interdisziplinär angelegt ist. Der inhaltliche Austausch war mit sehr vielen verschiedenen Menschen aus sehr vielen verschiedenen Fachbereichen möglich. Es fand auch die Begegnung mit Vertreter/innen verschiedener Feminismen statt und ich hatte nun die Möglichkeit in jener Schärfe Ungleichheitsverhältnisse zu beschreiben, wie ich es in der Publikation tue, und den Fokus auch auf postkoloniale Problematiken zu richten. Hierbei ging es mir darum, sukzessive zu klären, was Studierende eigentlich wissen wollen und vor allem was sie wissen sollten um den Beruf des Modedesigners/der Modedesignerin zu verstehen und im besten Falle gerne ausüben zu lernen.
Du verweist auch auf die Geschichte der Modewissenschaft, die ein recht junges Feld ist. Was sind die Gründe dafür, dass Modetheorie/Fashion Studies nicht mehr nur im Rahmen von Soziologie, den Kunstwissenschaften oder anderen Disziplinen diskutiert werden, sondern sich mittlerweile als eigene Disziplin etabliert?
Ich würde dies mit der allgemeinen Akademisierung des Designs erklären. Die erste Gestaltungstätigkeit, wo man einen höheren akademischen Grad erreichen konnte, war unter den Gestaltungsdisziplinen die Architektur. Die Architektur war sowohl als künstlerische Disziplin, Handwerk als auch Ingenieurswissenschaft immer schon eher im akademischen Feld verhaftet und als letztendlich fast alle Designdisziplinen, wie etwa die Grafik, im Rahmen der Aufwertung der künstlerischen Ausbildungsinstitutionen nunmehr an Universitäten gelehrt werden, kam ebenso die Bekleidungsgestaltung in diesen Genuss.
Ich möchte ein paar Punkte aufgreifen, die Du ansprichst, in denen es um aktuelle Diskurse bei Modedesign geht. Als erstes interessiert mich der Aspekt des Designers, welcher, wie Du mit Bezug auf Andreas Reckwitz schreibst, heute einem Kreativstar gleicht. Was für eine Persönlichkeit muss der Modedesigner/die Modedesignerin haben, um sich so zu inszenieren?
Die soziale Rolle des „Kreativstars“, wie sie von Andreas Reckwitz in seinem Buch zur „Erfindung der Kreativität“ treffend analysiert wird, kann in der Praxis nur ein minimaler Anteil der aktiv tätigen Modedesigner/innen spielen. Die eigentliche Sache ist, dass der Rest der Akteure, die sozusagen hinter einem/r „großen“ Modedesigner/in stehen, im Rahmen der Vermarktung der Modelabels völlig ausgeschlossen bleibt. Die PR wird so sehr auf ein kreatives Einzelwesen fokussiert, um eine Fiktion einer Modedesignerpersönlichkeit zu schaffen, deren Person als „Image“ im Zentrum der „Geschichte“ steht, die dann die Aura der tatsächlichen Kollektionen tragen soll. Wer am Ende welche Rolle wie inszeniert, hängt oft von sehr persönlichen Entscheidungen, teils auch von Zufällen ab und weniger von einer in irgendeiner Weise standardisierbaren Persönlichkeitsstruktur.


Du schreibst über den Kunst- und Designbetrieb, der mehr und mehr an eine größtmögliche Kommerzialisierung gekoppelt ist, und dass die Synergien zwischen Modedesign als angewandter Kunst und den bildenden und darstellenden Künsten sich dadurch verstärkt haben. Gelingen diese Synergien denn nun heute tatsächlich besser?
Die gelingen super! Ich selbst habe das bei Sylvie Fleury bereits Mitte der 1990er-Jahre gespürt. Sie hat ein Formel-1-Kleid mit jeder Menge Logos entworfen, und dieses, wie ich mich zu erinnern meine, in Zusammenarbeit mit Hugo Boss gefertigt. Ihre Arbeiten gaben mir den ersten Anstoß, dass dies ein ganz großes Ding wird, dass Mode und Kunst zusammenfinden. Ich finde es aber auch spannend zu diskutieren, wie jenseits dieser Flut an immer neuen Modeausstellungen, heute dabei kritische Aspekte gezeigt werden können und eine echte reflexive Auseinandersetzung mit Modedesign bzw. der Textilindustrie zustande kommen sollte. Gerade Modeausstellungen sind im eigentlichen Sinne Werbeveranstaltungen für Designer/innenlabels, die als private Unternehmen geführt werden. Daher taucht natürlich die Frage nach den Werbeeffekten auf, die damit verbunden sind: Kann ein staatliches Museum Modeausstellungen von großen Firmen machen; ist das nicht nur eine ganz simple, obendrein subventionierte Werbemöglichkeit? Da muss es meines Erachtens nach noch Verschiebungen geben, und hier müsste es zukünftig möglich sein, die Dinge klarer zu benennen.
Ich möchte dabei auch auf den gesellschaftlichen Wandel zu sprechen kommen, der mit einer vermehrten Beteiligung des Einzelnen an künstlerischen Prozessen zu tun hat. Die Menschen wollen heute mitmachen und Dinge selbst mitgestalten. Die Mode bleibt davon nicht unberührt, wie wird sich das in Zukunft entwickeln?
Ja, dazu fallen mir spontan die kursierenden Videos und Bilder im Netz ein, wo Leute ihre Kleiderschränke präsentieren oder ihre neueste Einkaufsbeute zeigen – manche posten sich selbst in spektakulären Looks auf Instagram. Dies wird durchaus von Stylist/innen und Designer/innen rezipiert, und in gewissen Stilfragen beeinflussen diese Posts vielleicht auch Entscheidungen. Inwiefern dies in der Masse einen tatsächlichen Bubble-up-Effekt erzeugt, würde ich bezweifeln. Im Großen und Ganzen würde ich hier sagen, nein. Aus ökonomischer Wissenschaftsperspektive wäre dies in der Modebranche ohnehin ein Paradoxon, denn die Westliche Bekleidungsindustrie ist keine kundenbedarfsorientierte Industrie, die sich nach den Wünschen der Konsument/innen richtet, sondern sie muss Bedürfnisse erst erzeugen, um immer neue Absatzmärkte zu schaffen. Dies hatte schon Georg Simmel zur vorletzten Jahrhundertwende erkannt und dies trifft auch heute noch auf alle Preissegmente in der Modebranche zu.

In einem Teil des Buchs wird die Problematik der sogenannten Ethno-Mode behandelt. So schreibst Du, einige Stimmen aus dem Bereich der Anthropologie haben die unreflektierte, rein „formale“ Auseinandersetzung mit kolonialisierten Kulturen stark kritisiert, da diese Nachahmungen jeglicher Würde, welche z.B. der afrikanischen Ornamentik und Formgebung im rituellen Gebrauch innewohnt, beraubt sind. Wie meinst Du das?
Dass sozusagen in diesen Widerspiegelungen, die wir als Versatzstücke „anderer“, ethnisierter Kulturen in verschiedenen Westlichen Designer/innenkollektionen sehen, sich die Tragik eines noch immer kolonialisierenden Blicks zeigt. Wir sind heute immer noch in der Situation, dass z. B. afrikanische Designer/innen einfach marginalisiert sind, und zwar dahingehend, dass sie nach wie vor keine Stimme innerhalb der „Modewelt“ haben. Die Modeindustrie wie sie heute ist, ist einerseits ultraglobalisiert und multinational was die Absatzmärkte betrifft, aber andererseits, wer innerhalb dieser multinationalen Gesellschaft auch im ökonomischen Bereich das Sagen hat, ist, nach wie vor, wenn man es genau betrachtet, ein bestimmter Kreis an Menschen, der weiß und männlich ist. Da werden auch viele Anstrengungen unternommen, um sich dem entgegenzustemmen, prozentual ist dies jedoch ein Witz. Und dann gibt es auch das Problem, dass wenn People-of-Colour-Models vereinzelt Teilhabe bekommen, manchmal das Gefühl mitschwingt, dies dient irgendwie als Antirassismus-Deckmäntelchen. Es würde sich nur etwas ändern, wenn jeden Monat auf Westlichen Modezeitschriften, und nicht nur auf diesen, auch weltweit, People-of-Colour-Models abgebildet wären, dann wäre dies ein erstes klares antirassistisches Statement dafür, dass die Modebranche keine offensichtlichen ethnischen Präferenzen hat.
In den aktuellen Diskussionen tauchen auch immer häufiger moralische Bedenken gegen diverse Produktionsbedingungen auf. Du schreibst, dass es notwendiger denn je ist, von Modeschaffenden ökosoziale Verantwortung einzufordern. Das stellt die Modeindustrie vermutlich auch vor neue Herausforderungen?
Das Berufsbild des Modedesigners/der Modedesignerin ist ein historisch gewachsenes Berufsbild, welches in bestehende ökonomische und ökologische Strukturen eingebettet ist; diese zum Positiven zu verändern ist aus meiner Perspektive auch zum Teil Aufgabe der Modeindustrie. Ökosoziale Verantwortung sollte letztlich auch jede/n Gestalter/in antreiben, aus einem einfachen egoistischen Grund: Bei Eintritt von gröberen ökologischen oder humanitären Katastrophen wird sich kein Mensch fürs Modedesign in der heutigen Form mehr interessieren. Hier sehe ich ein Problem im aktuellen Schisma zwischen der so genannten Techno Fashion und der Öko-Modebewegung, die heute unter den Schlagwörtern Eco, Green, Organic, Ethical, Social et cetera Fashion bekannt ist – ich denke beide Bereiche sollten grundsätzlich das Gestaltungsparadigma verbinden, lebensnotwenige Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten, ohne dabei die Bedürfnisse einzelner Menschen zu vernachlässigen. Kurzum, ohne frische Luft atmen zu können, nutzt beim Joggen auch das tollste Herzfrequenzen messende Wearable nichts.
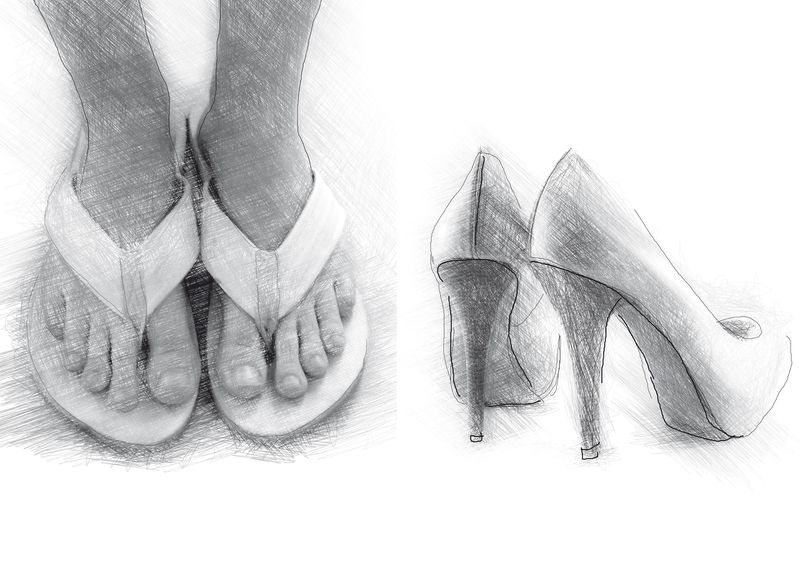
Barbara Schmelzer-Ziringer ist Dozentin für Modegeschichte und -designtheorie und ist unter anderem an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz tätig. Des Weiteren lehrt sie mit dem Schwerpunkt Gender Studies im Kreativbereich und hat Modedesign-Kurse mit Spezialisierung auf die Schnittgestaltung geleitet.
Text: Berenika Partum studierte Kunstgeschichte und Geschichte an der Freien Universität Berlin und Kultur- und Medienmanagemt an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Sie arbeitet bei internationalen Ausstellungen als Koordinatorin und Künstlerassistentin und war Projektmanagerin im Bereich Neuer Medien. Seit vielen Jahren ist sie auch als freie Publizistin und Kuratorin tätig.
Alle Illustrationen © Jaël Rabitsch